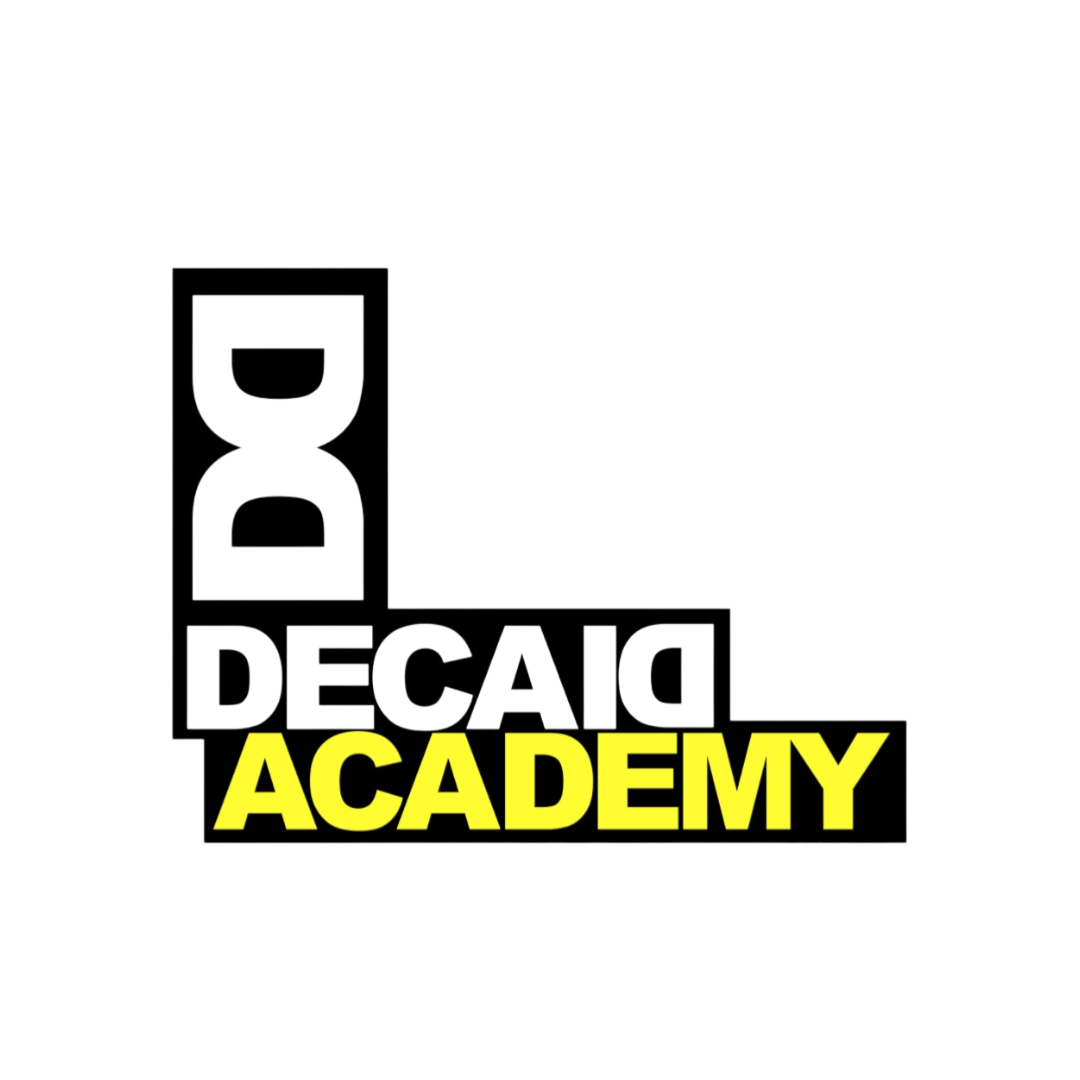AI Act in der Praxis: Was Du jetzt wissen musst und tun kannst
Jan 5
/
Kai Hermsen
Hier lernst du, wie du den AI Act nicht nur verstehst, sondern direkt ins Handeln kommst – und aus regulatorischen Pflichten einen echten Wettbewerbsvorteil machst. Statt dich in juristischen Details zu verlieren, bekommst du einen klaren Fahrplan und praxisnahe Tools, um die Umsetzung Schritt für Schritt anzugehen. Du lernst:
✅ Warum der risikobasierte Aufbau des AI Act sinnvoll ist – und was das konkret für deine Anwendungen bedeutet
✅ Welche Mythen rund um Innovation, Compliance-Kosten und KMU-Belastung du getrost ignorieren kannst
✅ Welche sieben Umsetzungsschritte wirklich relevant sind – von der Bestandsaufnahme bis zum Monitoring
✅ Wie du Transparenz, Governance und Mitarbeiterschulung pragmatisch in den Alltag integrierst
✅ Und: Warum frühe Compliance nicht nur Sicherheit schafft, sondern zur Positionierungschance im Markt wird
Der EU AI Act ist das erste umfassende KI-Gesetz weltweit – und er betrifft praktisch jedes Unternehmen, das heute KI einsetzt. Ob ChatGPT im Tagesgeschäft, automatisierte Texterstellung oder interne Assistenzsysteme: Die regulatorischen Vorgaben sind nicht länger Zukunftsmusik, sondern bereits Realität. Trotzdem herrscht in vielen Organisationen noch Unsicherheit. Was genau regelt der Act? Welche Pflichten gelten für wen? Und wie nähert man sich dem Thema pragmatisch?
Dieser Artikel fasst die wichtigsten Punkte des Gesetzes zusammen – und bietet einen strukturierten Umsetzungsfahrplan für Unternehmen, die nicht nur compliant sein wollen, sondern den AI Act auch als strategische Chance begreifen.
1. Das Prinzip hinter dem Gesetz: Risiko steuert Regulierung
Der EU AI Act orientiert sich nicht an Technologiearten oder Anbietern, sondern an dem Risiko, das von einer KI-Anwendung ausgeht. Je größer das potenzielle Risiko für Grundrechte, Sicherheit oder demokratische Prinzipien, desto schärfer die regulatorischen Anforderungen. Das sorgt für Flexibilität und Praktikabilität.
Die vier Risikoklassen im Überblick:
- KI-Systeme mit inakzeptablem Risiko sind vollständig verboten. Dazu zählen etwa Social Scoring-Systeme, manipulative Nudging-Techniken oder biometrische Überwachung im öffentlichen Raum. Diese Verbote gelten bereits seit Februar 2025.
- Hochrisiko-Systeme sind Anwendungen, die in sensiblen Bereichen wie Medizin, Bildung, Strafverfolgung oder kritischer Infrastruktur zum Einsatz kommen. Hier gelten weitreichende Anforderungen an Dokumentation, Risikomanagement, Datenqualität, Sicherheit und menschliche Kontrolle.
- Systeme mit begrenztem Risiko – wie Chatbots oder KI-gestützte Content Tools – unterliegen vor allem Transparenzpflichten. Nutzer müssen erkennen können, dass sie mit KI interagieren oder KI-generierte Inhalte konsumieren.
- Systeme mit minimalem Risiko, etwa Spamfilter oder Games, müssen lediglich allgemeinen Rechtsnormen genügen.
Für sogenannte General Purpose AI – also Modelle wie GPT, Claude oder Gemini – gelten zudem eigene Regeln, unabhängig vom Anwendungsfall. Anbieter dieser Modelle müssen unter anderem Trainingsdaten offenlegen und technische Dokumentationen bereitstellen.
2. Die häufigsten Missverständnisse
Rund um den AI Act kursieren viele Mythen. Drei besonders verbreitete Annahmen halten einer genaueren Betrachtung nicht stand:
„Der AI Act verhindert Innovation“ – Tatsächlich betrifft die strengste Regulierung nur etwa 20 Prozent aller KI-Anwendungen. Für den Großteil – insbesondere im Marketing, der Kommunikation und internen Automatisierung – gelten moderate Vorgaben. Zudem schaffen klare Regeln Vertrauen bei Kunden und Investoren.
„Nur große Konzerne sind betroffen“ – Der AI Act gilt extraterritorial. Das heißt: Alle Anbieter, die KI-Systeme im europäischen Markt bereitstellen, unterliegen den Regeln – egal, ob sie aus den USA, China oder Deutschland kommen.
„Die Compliance-Kosten sind untragbar“ – Die Realität ist differenzierter. Für Hochrisiko-Systeme sind höhere Anforderungen gerechtfertigt. Für die Mehrheit der Anwendungen jedoch geht es vor allem um saubere Prozesse, verständliche Kennzeichnungen und dokumentierte Entscheidungen – also Dinge, die ohnehin zur Good Practice gehören.
3. Was Unternehmen jetzt konkret tun sollten
Die Vorschriften des AI Act greifen stufenweise. Einige Pflichten gelten bereits seit Anfang 2025, andere folgen bis spätestens August 2027. Um nicht in Rückstand zu geraten – und um Chancen zu nutzen – lohnt sich ein strukturierter Umsetzungsfahrplan. Folgende sieben Schritte haben sich in der Praxis bewährt:
Schritt 1: KI-Inventar erstellen
Der erste Schritt ist eine ehrliche Bestandsaufnahme. Welche KI-Anwendungen werden im Unternehmen genutzt – bewusst oder unbewusst? Dazu zählen Offensichtliches wie ChatGPT, aber auch automatische Texthilfen in CRM-Systemen, Empfehlungsalgorithmen oder Content-Tools. Für jedes System sollte dokumentiert werden:
- Wer nutzt es und wofür?
- Welche Daten werden verarbeitet?
- Wie relevant ist das System für geschäftliche Entscheidungen?
Schritt 2: Schulungspflicht ernst nehmen
Seit Februar 2025 sind Unternehmen verpflichtet, Mitarbeitende mit KI-Zugriff in grundlegenden KI-Kompetenzen zu schulen. Das betrifft technische Grundlagen ebenso wie rechtliche und ethische Aspekte. Ziel ist es, Risikobewusstsein zu fördern und souveränen Umgang mit den Tools zu ermöglichen.
Startpunkt sind meist diejenigen Teams, die regelmäßig mit KI arbeiten (z. B. Marketing, HR, Innovation). Perspektivisch sollten auch Führungskräfte und Entscheidungsträger eingebunden werden.
Schritt 3: Governance-Strukturen definieren
Regelkonforme KI-Nutzung braucht klare Verantwortlichkeiten. In der Praxis hat sich die Einrichtung eines interdisziplinären KI-Gremiums bewährt – mit Vertreter:innen aus Legal, Datenschutz, IT und den Fachabteilungen. Es geht darum, folgende Fragen zu klären:
- Wer entscheidet über den Einsatz neuer Tools?
- Wie werden Risiken bewertet?
- Wer dokumentiert und überwacht die Nutzung?
Gerade in kleinen Unternehmen kann diese Rolle zunächst bei einer verantwortlichen Person gebündelt werden – idealerweise mit Zugang zu externer Beratung.
Schritt 4: Interne KI-Richtlinie formulieren
Eine KI-Richtlinie schafft Orientierung im Alltag – insbesondere für den Einsatz von generativen Tools. Sie sollte u. a. regeln:
- Welche Systeme dürfen eingesetzt werden – und unter welchen Bedingungen?
- Wie sieht ein Genehmigungsprozess aus?
- Welche Transparenzstandards gelten gegenüber Kunden und Stakeholdern?
Die Richtlinie sollte dabei nicht akademisch formuliert sein, sondern praxisnah, verständlich und umsetzbar.
Schritt 5: Risikobewertung implementieren
Für jede Anwendung sollte geprüft werden, in welche Risikokategorie sie fällt. Bei Hochrisiko-Systemen sind Maßnahmen wie Risikomanagement, Qualitätssicherung und kontinuierliche Überwachung verpflichtend. Bei Systemen mit begrenztem Risiko reicht meist eine nachvollziehbare Dokumentation und Transparenz.
Wer früh beginnt, kann einheitliche Bewertungskriterien im Unternehmen etablieren. Praktikable Checklisten oder einfache Self-Assessments erleichtern die Kategorisierung.
Schritt 6: Transparenz-Standards einführen
Nutzer:innen müssen erkennen, wenn sie mit KI interagieren – etwa bei Chatbots, automatisierten Mails oder AI-generierten Texten. Ebenso müssen KI-generierte Inhalte entsprechend gekennzeichnet werden. Diese Anforderungen lassen sich mit internen Guidelines, Wording-Empfehlungen und abgestimmten Workflows gut operationalisieren.
Schritt 7: Dokumentation und Monitoring aufsetzen
Der AI Act verlangt nicht nur punktuelle Nachweise, sondern kontinuierliche Nachvollziehbarkeit. Dokumentiert werden sollten:
- eingesetzte Tools und Anwendungen
- Schulungen und Kompetenzmaßnahmen
- Entscheidungen zu Genehmigung, Risiko und Governance
- technische Dokumentationen bei Hochrisiko-Systemen
Regelmäßige Reviews und ein Monitoring-System sichern die Qualität – und machen künftige Audits handhabbar.
4. Von der Pflicht zur Positionierung
Viele Unternehmen betrachten Compliance primär als Aufwand. Doch in Wahrheit liegt hier ein strategischer Hebel: Wer seine KI-Nutzung frühzeitig professionalisiert, kann dies nach innen wie außen als Qualitätsmerkmal positionieren. Gerade in Kundensegmenten mit hohen Anforderungen an Datenschutz und Transparenz entsteht ein echter Wettbewerbsvorteil.
Zudem zeigt der „Brussels Effect“ – also die Tendenz, dass europäische Regulierung global zum Standard wird –, dass sich Investitionen in Compliance mittel- und langfristig auszahlen. Nicht zuletzt schafft der AI Act Klarheit in einem technologischen Umfeld, das bisher oft von Unsicherheit und Überforderung geprägt war.
Fazit
Der AI Act zwingt Unternehmen, sich strukturiert mit ihrer KI-Nutzung auseinanderzusetzen – und das ist eine gute Nachricht. Wer den Prozess nicht als reines Compliance-Thema, sondern als strategischen Hebel versteht, kann Transparenz, Qualität und Vertrauen systematisch stärken. Mit einem klaren Fahrplan, einer realistischen Einschätzung des eigenen Risikoniveaus und einer passenden Governance-Struktur wird aus einer regulatorischen Pflicht ein Wettbewerbsvorteil. Unternehmen, die jetzt starten, sind nicht nur regelkonform – sie werden auch anschlussfähig für eine zunehmend KI-geprägte Wirtschaft.
Copyright © 2025
Lernpfad erfolgreich gestartet
Der ausgewählte Lernpfad wurde deiner Start-Seite hinzugefügt. Du findest alle enthaltenen Kurse auf dieser Seite.